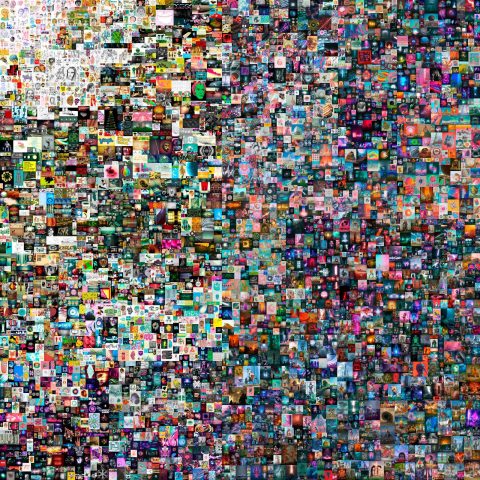Kunst im Dienste der Partei
Während sich die westliche Kunstwelt in den 1950er Jahren dem Abstrakten zuwendet, gilt in der DDR die Doktrin des Sozialistischen Realismus. Die SED signalisiert „einen radikalen Umschwung auf allen Gebieten des kulturellen Lebens“. In einem Beschluss der Partei vom März 1951 heißt es:
„Formalismus bedeutet Zersetzung und Zerstörung der Kunst selbst. (…) Überall, wo die Frage der Form selbständige Bedeutung gewinnt, verliert die Kunst ihren humanistischen und demokratischen Charakter.“
In der DDR wurde „Formalismus“ als Kampfbegriff gegen jedwede Form von Abstraktion in Kunst, Literatur und Musik eingesetzt. Selbst Malern wie Pablo Picasso, Marc Chagall oder Fernand Léger warf man vor, sich unter dem Vorwand der künstlerischen Freiheit hinter der Abstraktion zu verstecken und damit Wirklichkeitsfälschung zu betreiben. Dies sei Kennzeichen westlicher Dekadenz und „Ausdruck des kapitalistischen Niedergangs“.
Die neue Kunst des noch jungen Staates hingegen soll nah an der Wirklichkeit sein, gänzlich auf Abstraktion verzichten, den sozialistischen Arbeitsalltag möglichst optimistisch darstellen und der Umerziehung der Menschen im Geist des Sozialismus dienen. Mit anderen Worten: Der sozialistische Staat schreibt den Künstlerinnen und Künstlern fortan ganz konkret vor, wie sie zu arbeiten haben – und wie nicht.
Nachdem die staatliche Ausbildung und auch der Ausstellungsbetrieb zügig auf die neue Kunstdoktrin umgestellt worden waren, verlässt eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern die DDR – darunter Gotthard Graubner (1954), Eugen Schönebeck (1955), Georg Baselitz (1958) und Gerhard Richter (1961).
Der in Halle an der Saale lebende Maler Willi Sitte dagegen, der von den Kulturfunktionären in schärfster Art und Weise als „Formalist“ attackiert und später sogar zu einer öffentlichen Selbstkritik gezwungen wird, bleibt als überzeugter Kommunist im Land.